IT-SicherheitMobile Integrität wahren
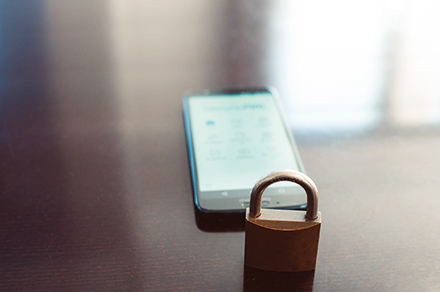
Auf dem Smartphone VS-NfD-konform texten.
(Bildquelle: Virtual Solution)
Termine vereinbaren, Personal koordinieren, Dokumente bearbeiten, sich mit anderen Dezernaten austauschen – eine schnelle Kommunikation und flexibles Arbeiten können den Behördenalltag sehr erleichtern. Besonders im Außendienst ist es von Vorteil, wenn Ordnungsämter, Forstverwaltung oder Aufsichtsbehörden von unterwegs aus tätig sein können: Der Mitarbeiter fotografiert die vorgefundene Situation, macht sich Notizen, greift auf Fachanwendungen im Behördennetzwerk zu, hat direkte Akteneinsicht und kann Dateien via E-Mail oder Messenger an seine Kollegen weiterleiten.
Andererseits lauern beim mobilen Arbeiten zahlreiche Risiken. Gerade wenn Mitarbeiter private Geräte im Rahmen von Bring Your Own Device (BYOD) für dienstliche Aufgaben verwenden oder dienstlich bereitgestellte Geräte nach dem COPE-Prinzip, kurz für Corporate Owned, Personally Enabled, auch privat nutzen dürfen. Veraltete Betriebssysteme, unsichere WLAN-Verbindungen und die Nutzung von Apps, die es mit der Privatsphäre nicht so genau nehmen, sind häufig Einfallstore für Cyber-Kriminelle und der Grund für Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Systematische Verstöße gegen Datenschutz-Grundverordnung
Bei Verletzungen der Datenschutzbestimmungen drohen den Verantwortlichen in der öffentlichen Verwaltung nicht nur disziplinarische Maßnahmen, sondern aufgrund ihrer Vorbildfunktion auch ein Vertrauensverlust seitens der Bürger. Trotzdem mussten sogar Bundesbehörden zu Beginn der Corona-Pandemie ihre IT-Infrastruktur für private Geräte öffnen, denn sie konnten nicht allen Mitarbeitern dienstliche Mobilgeräte zur Verfügung stellen.
Problematisch sind weit verbreitete Dienste wie WhatsApp, die in Behörden viel genutzt werden. Die App liest die Adressbücher der Mitarbeiter mit den Kontaktdaten von Kollegen und Lieferanten aus und gibt die Daten an die Konzernmutter Facebook weiter. Darüber hinaus erfasst WhatsApp auch Metadaten, etwa GPS-Daten, Absturzberichte und Nutzerverhalten. Viele Behörden haben für diese Dienste keine Nutzungsregelungen aufgestellt oder dulden sie stillschweigend. Dabei hat der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) dem Messenger-Dienst zuletzt wiederholt systematische Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung vorgeworfen und gerade deutsche Bundesbehörden daran erinnert, dass ein offizieller Einsatz nicht möglich ist.
Private und dienstliche Daten trennen
Trotz der bekannten Sicherheitsmängel läuft die informelle dienstliche Kommunikation innerhalb von Behörden häufig über WhatsApp und andere Dienste ab. In der Praxis wird privat und dienstlich unter Kollegen nicht sauber getrennt – mit weitreichenden Konsequenzen. Besonders kritisch wird die Lage, wenn zum Beispiel auf Ministerialebene oder bei Polizeibehörden Informationen mit der Einstufung „Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch (VS-NfD)“ mobil verarbeitet werden sollen.
Der einzige Ausweg ist eine strikte Trennung zwischen privaten und dienstlichen Daten auf den Mobilgeräten der Mitarbeiter. Dabei ist es unerheblich, ob Behörden die Nutzung privater Smartphones und Tablets für dienstliche Zwecke erlauben oder umgekehrt. Eine Kommunikationslösung, die auf einer Container-Technologie wie SecurePIM Government basiert, speichert Behördendaten in einem verschlüsselten Bereich, sodass diese strikt von persönlichen Daten und Kontakten getrennt sind. Auch jeglicher Datentransport ist dabei Ende-zu-Ende verschlüsselt. Für den Mitarbeiter, der gerade seine dienstlichen E-Mails abruft, ist es nicht möglich, aus der abgesicherten App heraus auf persönliche Anwendungen zuzugreifen. Umgekehrt können auch keine privaten Anwendungen auf die dienstlichen Inhalte zugreifen.
Nutzerfreundlich mobil arbeiten
Eine moderne Lösung für die mobile Kommunikation muss den Mitarbeitern ein Büro in Miniformat an die Hand geben, mit dem sie ihr Tagesgeschäft problemlos erledigen können. Damit stehen zum Beispiel alle aus Outlook und Notes bekannten Funktionen wie E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen zur Verfügung. Auch ein gehärteter Browser für webbasierte Fachanwendungen und sicheres File-Sharing sind ein Muss. So können Behördenmitarbeiter Dokumente sicher abrufen, bearbeiten und wieder ablegen. Die mobile Kommunikationsanwendung SecurePIM Government des Unternehmens Virtual Solutions bietet zusätzlich einen Messenger inklusive verschlüsselter Telefonie, der neben Einzel- auch Gruppen-Chats, Videotelefonie, Sprachanrufe und Dokumentenversand beinhaltet.
Für Behörden, die mit Geheimhaltungsstufe VS-NfD arbeiten müssen, gibt es die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für das Betriebssystem iOS zugelassene und für das Betriebssystem Android freigegebene Systemlösung SecurePIM Government SDS. Über 25 Bundesbehörden haben diese in den vergangenen drei Jahren auf Tausenden von Endgeräten ausgerollt. Leistungsstarke Tablets, wie zum Beispiel ein iPad Pro, bieten den Mitarbeitern jetzt auch für Verschlusssachen einen vollwertigen, flexiblen Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter können so bequem und nutzerfreundlich mobil arbeiten und kommunizieren – die Integrität und Sicherheit der Behördendaten ist jederzeit gewährleistet.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Januar 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Sachsen: SDTB-Tätigkeitsbericht 2024
[17.04.2025] Die Datenschutzbeauftragte des Freistaats Sachsen hat ihren Tätigkeitsbericht für 2024 vorgelegt. Häufige Probleme betrafen fehlerhafte Webseiten, unzulässige Datenverarbeitung in Behörden und Defizite beim Umgang mit Auskunftsersuchen. mehr...
BfDI: 33. Tätigkeitsbericht vorgestellt
[15.04.2025] Die BfDI Louisa Specht-Riemenschneider hat ihren ersten Tätigkeitsbericht vorgelegt. Sie fordert mehr Beratung für KI-Projekte sowie einen anwendbaren Datenschutz und kündigt an, Missstände bei der Umsetzung der Informationsfreiheit stärker zu adressieren. mehr...
BSI/ZenDiS: Sichere Softwarelieferketten
[11.04.2025] Software besteht mitunter aus tausenden Einzelkomponenten – eine komplexe Softwarelieferkette. Deren Sicherheit ist ein wichtiges Element von IT-Sicherheit und digitaler Souveränität. ZenDiS und BSI zeigen nun in einem Strategiepapier samt Umsetzungsplan, wie die Überprüfung automatisiert werden kann. mehr...
ATHENE/DFKI: Gemeinsam forschen für Cybersicherheit und KI
[07.04.2025] Das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) vereinbaren eine enge Zusammenarbeit in der Forschung zur Cybersicherheit von und durch Methoden der Künstlichen Intelligenz. mehr...
BSI/AWS: Kooperation für souveräne Cloud
[27.03.2025] Gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Cloudstandards entwickeln, um die Sicherheit digitaler Infrastrukturen zu erhöhen. mehr...
Baden-Württemberg: Tätigkeitsbericht zum Datenschutz 2024 vorgelegt
[26.03.2025] Der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg, Tobias Keber, hat seinen Tätigkeitsbericht 2024 vorgelegt. Schwerpunkte waren die Beratung zu KI und Datenschutz – insbesondere auch für die Verwaltung –, die Umsetzung europäischer Vorgaben sowie die Beteiligung an Gesetzesvorhaben. mehr...
Cloud Computing: BSI und Schwarz Digits kooperieren
[21.03.2025] Mit einer Analyse der Angebote verschiedener Cloud-Provider trägt das BSI den mit Cloud Computing verbundenen Risiken sowie geopolitischen Entwicklungen Rechnung. Kooperationsverträge bilden den Rechtsrahmen, um eingehende technische Prüfungen durchzuführen. Nun wurde eine solche Vereinbarung mit Schwarz Digits geschlossen. mehr...
BSI: Schabhüser geht, Caspers kommt
[25.02.2025] Gerhard Schabhüser scheidet nach sieben Jahren als BSI-Vizepräsident aus, Nachfolger wird Thomas Caspers. In seiner Abschiedsrede forderte Schabhüser eine stärkere Rolle des BSI, etwa als Zentralstelle für Cybersicherheit in Bund und Ländern sowie als Marktaufsicht für den Cyber Resilience Act. mehr...
Bundesverwaltung: Wie steht es um die digitale Souveränität?
[17.02.2025] Die Bundesregierung berichtet über IT-Beschaffung und digitale Souveränität bei der Bundesverwaltung. Die genauen Details unterliegen Geheimhaltungsinteressen – die Regierung verweist jedoch unter anderem auf das OZG 2.0, Forschungs- und Förderprogramme und die geplante Vergabereform. mehr...
Hamburg: Kooperation mit dem BSI
[11.02.2025] Neue Technologien und eine zunehmende Digitalisierung der Verwaltung erhöhen die Anforderungen an die Abwehr von Cybergefahren. Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben nun eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. mehr...
Cyber Resilience Act: Stackable in Expertengruppe berufen
[15.01.2025] Das schleswig-holsteinische Unternehmen Stackable wurde von der Europäischen Kommission in die Expertengruppe zum Cyber Resilience Act aufgenommen. Die Gruppe soll die Umsetzung der Verordnung zur Cybersicherheit in der EU unterstützen. mehr...
IT-Sicherheitsdienstleister: Schneller zum BSI-Zertifikat
[06.01.2025] Das BSI hat einige Zertifizierungsverfahren für IT-Sicherheitsdienstleister modernisiert, um sie zu beschleunigen. Solche Zertifikate sind für den Einsatz im öffentlichen Sektor verpflichtend, bieten aber auch Unternehmen im freien Markt Vorteile. mehr...
Baden-Württemberg/Bayern/Hessen: Kooperation für starke IT-Sicherheit
[11.12.2024] Die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg, das bayerische Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Hessens CyberCompetenceCenter bündeln ihre Kräfte. Gemeinsam wollen sie eine schlagkräftige Allianz für mehr IT-Sicherheit bilden. mehr...
Sachsen: Tausende Cyberattacken auf Landesbehörden
[02.12.2024] Der Jahresbericht Informationssicherheit bilanziert den Stand der Cybersicherheit in der sächsischen Verwaltung. Angriffe auf Behörden nehmen demnach zu – so wurde rund die Hälfte der eingehenden Mails blockiert. Maßnahmen wie die NIS2-Umsetzung und eine 24/7-Bereitschaft beim SAX.CERT stärken den Schutz. mehr...
BSI: Bericht zur Lage der IT-Sicherheit
[12.11.2024] Die Bedrohungslage bliebt angespannt, die Resilienz gegen Cyberangriffe aber ist gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland hervor, den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nun vorgestellt hat. mehr...












