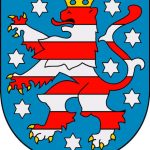OZGMehr Mut zur Entscheidung

Dr. Sönke E. Schulz ist Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags.
(Bildquelle: Schleswig-Holsteinischer Landkreistag)
Herr Schulz, wie weit ist die Verwaltung aus Ihrer Sicht bei der Digitalisierung vorangekommen?
In vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, insbesondere bei Bund und Ländern, wird die Digitalisierung als einzelnes Thema gesehen, das in einem Ministerium oder einer Stabsstelle behandelt wird, anstatt es ganzheitlich und über alle Ebenen hinweg anzugehen. Dabei ist ganz klar: In jedem Bereich der Verwaltung muss Veränderung durch Digitalisierung ein Thema sein. Diese Erkenntnis ist inzwischen bei einigen durchgedrungen, insofern sehe ich schon Fortschritte. Es gibt allerdings immer noch ganz klassische hierarchische Verwaltungen, in denen die Digitalisierung überhaupt nicht angekommen ist.
Bringt das Onlinezugangsgesetz (OZG) nun neuen Schwung?
Seit bekannt ist, dass das OZG kommt, haben wir als kommunaler Spitzenverband vom Land Schleswig-Holstein klare Rahmenbedingungen gefordert. Es sollte geklärt werden, was die Basisdienste sind, zu welchen Bedingungen die Verfahren zur Verfügung gestellt werden, was das Land übernimmt und was die Kommunen. Aus meiner Sicht wird die größte Lücke bei der OZG-Umsetzung derzeit von einigen Ländern gelassen. Der Bund geht strategisch konzeptionell voran, auch die Kommunen sehen, dass sie etwas tun müssen. Allerdings sind sie auf den Landesgesetzgeber angewiesen. Ich würde mir wünschen, dass die Länder zum Beispiel bei den Basisdiensten durchaus auch mal Vorgaben machen. Aber der Mut zur Entscheidung fehlt.
Wie sieht es in Schleswig-Holstein aus?
Nach meiner Erfahrung gibt es in Schleswig-Holstein viele Landräte und Bürgermeister, die sagen, dass man mit dem ständigen Verweis auf die kommunale Selbstverwaltung und Forderungen nach einer Landesfinanzierung beim Thema Digitalisierung nicht mehr weiterkommt. Die Länder fürchten diesen Reflex der Kommunen. Sie müssen daher wie erwähnt klare Rahmenbedingungen setzen und schon früh die kommunalen Anforderungen aufnehmen und berücksichtigen. Die Digitalisierung kann nur gemeinsam gestaltet werden.
Wie kann eine solche gemeinsame Gestaltung gelingen?
Wir sind in Gesprächen mit der Landesregierung, und es gibt einen E-Government-Beirat. Dort haben wir uns zwar über verschiedene Punkte verständigt, aber es existieren keine echten Entscheidungsstrukturen. Bei der Umsetzung des OZG wäre aber eine gemeinsame Steuerungsgruppe nötig. So ein Gremium haben wir in Schleswig-Holstein noch nicht etabliert.
Welche Rolle spielt das E-Government-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein?
Das E-Government-Gesetz regelt das Verhältnis zwischen Land und Kommunen. Es können per Verordnung Standards gesetzt und bestimmte Fachverfahren vorgeschrieben werden. Das Gesetz gilt seit 2009, von den Möglichkeiten wurde aber nie wirklich Gebrauch gemacht. Wir haben also das Instrumentarium, um die Digitalisierung voranzubringen, nutzen es aber nicht.
Kann die Software-Wirtschaft dazu beitragen, mehr Schwung in die Sache zu bringen? Das Lübecker Unternehmen MACH hat ja mit der Landesregierung ein Innovation Lab gegründet?
Das kann helfen, weil gemeinsam mit Kommunen und Behörden an Lösungen gearbeitet werden soll. Diese können dann standardisiert über das ganze Land ausgerollt werden.
„Wir haben das Instrumentarium, um die Digitalisierung voranzubringen, nutzen es aber nicht.“
Wie sollte die Zusammenarbeit der Kommunen mit dem Land idealerweise aussehen?
Es läuft ja meist so, dass man im Gespräch ist, und die Landesregierung trifft die Entscheidung. Das ist bei der Digitalisierung nicht besonders ausgeprägt, weil das Land den Kommunen nicht hineinregieren will. Wie schon angesprochen, glaube ich, dass echte Entscheidungsgremien etabliert werden müssen. Hier können auch strittige Punkte diskutiert und einer Lösung zugeführt werden.
Was muss auf kommunaler Ebene geschehen?
Wir müssen uns als Kommunen organisatorisch stärken – das ist jetzt in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht: Die drei kommunalen Spitzenverbände des Landes haben zum 1. Januar 2019 eine gemeinsame Anstalt gegründet. Insbesondere die Standardisierung soll hier vorangetrieben werden. Wenn diese Organisation erfolgreich ist, kann deren Chef als kommunaler Chief Digital Officer perspektivisch der zentrale Ansprechpartner für das Land und für den IT-Dienstleister Dataport sein.
Es ist viel die Rede von neuen Technologien, etwa künstlicher Intelligenz (KI). Wo sehen Sie konkrete Einsatzmöglichkeiten?
Künstliche Intelligenz klingt so hochtrabend. Ich glaube, die Abgrenzung zwischen KI und Verwaltungsautomatisierung ist fließend. Es gibt viele Standardprozesse, bei denen wir mit KI-Lösungen eine wirkliche Entlastung erreichen können. Ein gutes Beispiel sind Chatbots, mit denen Anfragen relativ gut beantwortet werden können. Auch bei vielen Antragsverfahren, etwa für das Elterngeld, können KI-Lösungen unterstützen. Das Bußgeldverfahren ist zwar schon weitgehend automatisiert, aber hier gibt es noch Verbesserungspotenzial hin zu einem durchgängigen Prozess inklusive Bezahlung. Mittels KI kann beispielsweise identifiziert werden, ob die Person auf einem Blitzerfoto erkennbar ist. Fälle, in denen das Klagerisiko hoch ist, können so aussortiert werden. Insgesamt gilt: Mit diesen Technologien können Personalressourcen freigemacht werden für Aufgaben, die tatsächlich nur von Menschen erledigt werden können.
Welche Anwendungsfälle machen Sie für die Zukunft aus?
Das Innovation Lab wurde genau zu diesem Zweck gegründet: Um zu erforschen, welche Möglichkeiten Technologien wie KI, Virtual oder Augmented Reality für die öffentlichen Verwaltungen bieten. Hilfreich wäre in jedem Fall eine Digital-First-Strategie, das heißt, der digitale Zugang zur Verwaltung sollte der Normalfall sein.
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung?
Ich verliere meinen Optimismus nicht. In fünf Jahren werden wir deutlich weiter sein. Auf Landesebene sollte jeder Minister auch für das Digitale zuständig sein und auf kommunaler Ebene brauchen wir ganz andere Strukturen für die Digitalisierung. Kreise und kreisfreie Städte können eigenständig agieren, aber kleinere Kommunen sind dazu nicht in der Lage. Hier sollten Aufgaben großflächig in Shared-Service-Center ausgelagert werden. Wenn das nicht gelingt, wenn immer noch jeder sein eigenes Ding macht, verbrennen wir Geld und Ressourcen. Zudem müssten die Kreise mehr für die kreisangehörigen Gemeinden tun, sind aber derzeit mit den eigenen Aufgaben der Digitalisierung gut ausgelastet.
Dieser Beitrag ist in der Februar-Ausgabe von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
NKR: Modernisierungsagenda bleibt zu vorsichtig
[10.12.2025] Die föderale Modernisierungsagenda ist beschlossen. Der NKR sieht darin wichtige Impulse für leistungsfähigere Verwaltungen, kritisiert jedoch vertagte Reformhebel und fordert eine konsequente Umsetzung mit starker Einbindung der Kommunen. mehr...
Ministerpräsidentenkonferenz: Eine schnellere, digitalere Verwaltung
[08.12.2025] Auf der Konferenz der 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wurde ein 200-Maßnahmen-Paket für eine föderale Modernisierungsagenda beschlossen. Viele der Maßnahmen betreffen auch die Verwaltung und deren digitale Transformation. mehr...
BMDS: Wildwuchs der Bundes-IT zügeln
[05.12.2025] Das Bundesministerium für Digitales hat mit dem Zustimmungsvorbehalt ein wirkungsvolles Instrument erhalten, um Digitalprojekte und IT-Ausgaben über Ressortgrenzen hinweg zu steuern. So soll zentral für Kompatibilität, Effizienz und Einhaltung der strategischen Richtung gesorgt werden. mehr...
Sachsen-Anhalt: Zentrale Serviceagentur für Kommunen
[05.12.2025] Eine Machbarkeitsstudie aus Sachsen-Anhalt zeigt, dass eine zentrale Serviceagentur für Kommunen Verwaltungsabläufe beschleunigen und verbessern kann. Digitalministerin Lydia Hüskens kündigte an, dass ab 2026 sukzessive eine Unterstützungseinheit für Kommunen umgesetzt werden soll. mehr...
Berlin: Digitalisierungsschub für die Wirtschaftsverwaltung
[04.12.2025] Ein Jahr nach Vorstellung des Aktionskonzepts zur Verwaltungsdigitalisierung für die Berliner Wirtschaft zieht Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey eine positive Bilanz. Vieles laufe schneller als geplant, der Digitale Wirtschaftsservice DIWI wächst und erste Medienbrüche in Gewerbeverfahren werden abgebaut. mehr...
Staatsmodernisierung: Konferenz vor der Konferenz
[03.12.2025] Mit einer „Konferenz für einen zukunftsfähigen Staat“ in Berlin wollte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst die Weichen für die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz stellen, deren zentrale Themen Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung sein werden. mehr...
eco: Zu kleiner Etat für den digitalen Aufbruch
[02.12.2025] Im November einigte sich der Haushaltsausschuss auf den BMDS-Etat für 2026. Viel Spielraum hat das Digitalministerium dennoch nicht, moniert der Internetwirtschaftsverband eco. Die Gelder fließen größtenteils in längst geplante Vorhaben, Mittel für echte Innovationen wie etwa KI liegen bei anderen Häusern. mehr...
IT-Planungsrat: Wichtige Digitalvorhaben beschlossen
[27.11.2025] Der IT-Planungsrat hat bei seiner letzten Sitzung des Jahres zentrale Beschlüsse zur Verwaltungsdigitalisierung gefasst. Er konkretisiert die EUDI-Wallet-Anbindung, übernimmt den KI-Marktplatz MaKI, stärkt Open-Source-Beschaffung und verstetigt die EfA-Lenkungsgruppe. mehr...
Föderale Modernisierungsagenda: Jetzt muss gehandelt werden
[25.11.2025] Der Nationale Normenkontrollrat mahnt die in der Föderalen Modernisierungsagenda vorgesehene bessere Aufgabenbündelung mit Nachdruck an. Die Ministerien müssten dieses Projekt konsequent weiterverfolgen, um Effizienz und Entlastung der Kommunen zu sichern. mehr...
Digitalministerkonferenz: Verwaltung im Fokus
[25.11.2025] Auf der vierten Digitalministerkonferenz fassten die Digitalministerinnen und -minister der Länder zentrale Beschlüsse zur Staats- und Verwaltungsmodernisierung. Sie wollen den Deutschland-Stack vorantreiben, wollen „Digital Only“ verbindlich verankern und fordern Tempo bei der Registermodernisierung. mehr...
Registermodernisierung: NOOTS-Staatsvertrag verabschiedet
[24.11.2025] Das Gesetz zum Staatsvertrag über das Nationale Once-Only-Technical-System hat den Bundesrat passiert. Nach Angaben der Bundesregierung kommt damit die Registermodernisierung von Bund, Ländern und Kommunen voran. mehr...
EU-Summit: Das war der Gipfel zur europäischen Digitalen Souveränität
[20.11.2025] Der Gipfel für Europäische Digitale Souveränität brachte rund 1.000 Spitzenvertreterinnen und -vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Berlin zusammen. Das BMDS sieht darin den Startschuss für ein wettbewerbsfähigeres und souveräneres Europa. mehr...
Bund/BMDS: Der Digitalhaushalt steht
[17.11.2025] Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Haushalt 2026 für das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung mit einem Gesamtvolumen von rund 4,47 Milliarden Euro gebilligt. Damit verfügt das BMDS erstmalig über einen eigenen, vollständigen Einzelplan, hinzu kommen Mittel aus dem Sondervermögen. mehr...
Thüringen: Ärmel hoch für Bürokratierückbau
[14.11.2025] Die Thüringer Landesregierung hat das Erste Thüringer Entlastungsgesetz initiiert. Es soll Bürokratie abbauen, Verfahren digitalisieren und Kommunen, Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger entlasten. Der Landtag berät voraussichtlich noch im Dezember über das Gesetz. mehr...
Hamburg: Annika Busse ist die neue CIO
[10.11.2025] Annika Busse ist die neue CIO der Freien und Hansestadt Hamburg. Die bisherige stellvertretende Hamburg-CIO hat zum 1. November die Nachfolge von Jörn Riedel angetreten, der nach langjährigem Wirken in den Ruhestand verabschiedet wurde. mehr...