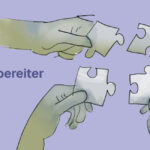MaternaChatbots auf dem Vormarsch

Chatbots kommen vermehrt im öffentlichen Sektor zum Einsatz.
(Bildquelle: wrightstudio/123rf.com)
Chatbots und Voicebots haben in diesem Jahr einen enormen Aufschwung erlebt. Zum einen ist die Technologie inzwischen etabliert. Zum anderen verzichten die Menschen Corona bedingt auf persönliche Kontakte und greifen vermehrt auf virtuelle Assistenten zurück. Die Technologie bietet der Verwaltung zahlreiche Vorteile. Dies hat zum Beispiel auch die Bundesverwaltung erkannt und den Chatbot C-19, besser bekannt als der Corona-Chatbot, bereitgestellt. Dieser liefert zu jeder Zeit Informationen, Aktuelles und Handlungsweisen im Rahmen der Covid-19-Pandemie – vollständig und ressortübergreifend. Ein weiteres Beispiel ist der digitale Assistent Guido des Gewerbe-Service-Portal.NRW des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Verwaltung. Guido unterstützt bei allen Fragen rund um die Gewerbeanmeldung.
Zwei Seiten profitieren
Von dem Einsatz profitieren gleich zwei Seiten – die Verwaltungsmitarbeiter und die Bürger. Das Personal in der Verwaltung wird nachhaltig entlastet. Ein Chatbot beantwortet wiederkehrende Fragen immer einheitlich, kann Termine vereinbaren, hilft beim automatisierten Vorausfüllen von Formularen und Anträgen sowie vielem mehr. Gleichzeitig profitieren Bürger vom Einsatz eines Bots: Warte- und Antwortzeiten verkürzen sich und Wege zu Behörden und Ämtern können reduziert werden. Chat- oder Voicebots helfen, Fehler zu vermeiden, da die digitalen Assistenten selbst passende Unterlagen vorsortieren und bereitstellen können. Chatbots sind eine moderne Kommunikationsform, die auch mehrsprachig konzipiert werden kann.
Anwendung und Aufbau
Die Anwendungsmöglichkeiten eines Chatbots sind zunächst unbegrenzt – ob nun für ein bestimmtes Ressort, einen bestimmten Kontaktpunkt (zum Beispiel die Website oder einen Social Media-Auftritt) oder für die interne und externe Kommunikation. Umso wichtiger ist es, die Ziele und den Einsatzweck eines Chatbots präzise festzulegen. Genau das macht den Erfolg von digitalen Assistenten wie Guido und dem Corona-Bot aus: Sie haben eine eindeutige Ausrichtung. Gleichzeitig müssen die angestrebten Fertigkeiten festgehalten werden. Soll der Chat- oder Voicebot etwa nur kommunizieren oder auch bei der Recherche und dem Vorausfüllen von Formularen unterstützen?
Sobald die Ziele und zu kommunizierende Inhalte feststehen, werden die Dialoge und die damit verbundene Didaktik des digitalen Assistenten konzipiert. Mit welcher Tonalität und Wortwahl soll etwa kommuniziert werden und in welcher Art und Weise sollen Bürger adressiert werden? Auch hier gilt es, eine genaue Struktur festzulegen. Im letzten Schritt wird das Aussehen des Chatbots definiert und es kann mit dem Aufbau begonnen werden.
Mehrgleisig fahren
Grundsätzlich gilt, dass eine Behörde auch mehrere Chat- oder Voicebots einsetzen kann. Die Entscheidung für einen oder gleich für mehrere digitale Assistenten hängt wesentlich vom Umfang der Inhalte ab. So kann beispielsweise auch ein einziger Chatbot für alle Anforderungen konzipiert werden. Ein dann wahrscheinlich riesiger Chatbot birgt allerdings das Risiko, dass die zugrundeliegende Dialoglogik die Pflege sehr unübersichtlich macht. Um dieses Risiko zu vermeiden, können Behörden alternativ viele kleine Chatbot-Lösungen einsetzen, die über ein einheitliches Redaktionssystem miteinander verbunden sind.
Für das kontinuierliche Trainieren und Pflegen des digitalen Assistenten empfiehlt es sich, eine Lösung zu nutzen, die auch Personen ohne technischen Hintergrund bedienen können – zum Beispiel ein Chatbot-Redaktionssystem. Eine solche Lösung besitzt eine strukturierte, einfache Benutzeroberfläche und signalisiert dem Redaktionsteam, sobald ein Dialog fehlerhaft ist. Gezielte redaktionelle Freigabeprozesse im Vier-Augen-Prinzip minimieren potenzielle Fehlerquellen, insbesondere inhaltlicher Natur.
Klare und verständliche Antworten
Ein Beispiel für eine solche Lösung ist der Chatbot des SPD Unterbezirks Remscheid, der in Zusammenarbeit mit Materna speziell für die NRW-Kommunalwahl 2020 konzipiert wurde. Kern des Systems war der komplette Umfang des 25-seitigen Wahlprogramms. Der Chatbot umfasste rund 25 so genannte Intents. Das sind Themen oder Kategorien, nach denen Nutzer typischerweise fragen. Für jede Kategorie wurden die relevanten Inhalte definiert, wie beispielsweise Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft. Auf alle Fragen lieferte der Chatbot klare und verständliche Antworten. Nutzer mussten also nicht lange suchen, sondern erhielten in kleinen Happen direkt die gewünschten Informationen zu den wichtigen Themen des Wahlkampfs.
Nicht nur der Hype um Technologien der Künstlichen Intelligenz, sondern auch die Gewohnheit der Nutzer an die stete Erreichbarkeit von Verwaltungen wird dazu führen, dass Bürger nicht mehr auf den Einsatz der lieb gewonnen digitalen Assistenten verzichten möchten.
Nordrhein-Westfalen: Der Beihilfebescheid kommt per App
[26.02.2026] Die rund 645.000 Beihilfeberechtigten in Nordrhein-Westfalen können ihre Bescheide ab sofort in digitaler Form erhalten. Möglich wird das durch eine neue Funktion der bereits etablierten BeihilfeNRW-App. Davon profitieren die Antragstellenden wie auch die Beschäftigten der Beihilfestellen. mehr...
Baden-Württemberg/Bayern: Software-Landschaft für die Gesundheitsämter
[17.02.2026] Baden-Württemberg und Bayern vereinbaren die Zusammenarbeit zur Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Grundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Ziel ist eine einheitliche, bürgerfreundliche Fachanwendungslandschaft. Die Kooperation steht weiteren Ländern und Kommunen offen. mehr...
Deutschland-Index Digitale Verwaltung 2025: Brandenburg holt auf
[16.02.2026] Der Index Digitale Verwaltung des ÖFIT zeigt: Brandenburg ist im Jahr 2025 der Aufsteiger schlechthin. Punkten kann die Verwaltung insbesondere mit der sehr guten Benutzbarkeit ihres Angebots. Schwachpunkte bleiben die Basiskomponenten und das Angebot an Online-Verwaltungsleistungen. mehr...
Low Code/No Code: Digitalisierung von innen
[13.02.2026] Es ist eine Mammutaufgabe, die Verwaltung einer großen Organisation zu digitalisieren. Das gilt auch für die Bundeswehr, die zudem vor zahlreichen weiteren Herausforderungen steht. Die Digitalisierung in Teilen in die Hände kleinerer Einheiten oder Teams zu geben, kann zu erheblichen Effizienzgewinnen führen. mehr...
Niedersachsen: Wie brauchbar sind Registerdaten?
[12.02.2026] Geht es um die Registermodernisierung, stehen vor allem technische Aspekte wie die Datenaustauschplattform NOOTS im Fokus. Ein Pilotprojekt in Niedersachsen hat nun die Qualität der Registerdaten selbst untersucht und gleichzeitig gezeigt, wie diese automatisiert verbessert werden kann. mehr...
Nordrhein-Westfalen: BAföG-Fachverfahren fürs ganze Land
[30.01.2026] In Nordrhein-Westfalen wird das Gros der Anträge auf BAföG und Aufstiegs-BAföG per Post oder E-Mail eingereicht. Nun soll ein neues Fachverfahren eingeführt werden – landesweit. Den Auftrag erhielt die Firma Datagroup. mehr...
ÖFIT-Wegbereiter-Reihe: Kompetenzaufbau in der Verwaltungspraxis
[30.01.2026] Als niedrigschwellige, anwendungsorientierte Lern- und Arbeitsinstrumente sollen die ÖFIT-Wegbereiter die interdisziplinäre Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung unterstützen. Die Reihe umfasst derzeit vier Ausgaben unter anderem zu den Themen Low Code, generative Künstliche Intelligenz und Digitale Souveränität. mehr...
Normenkontrollrat BW: Tätigkeitsbericht 2025 übergeben
[27.01.2026] Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat seinen zweiten Tätigkeitsbericht vorgelegt. Das Gremium fordert ein Umdenken in der Gesetzgebung, mehr Freiräume für flexible Lösungen vor Ort und entschlossene Schritte zum Bürokratieabbau. mehr...
DigitalService des Bundes: Neues zur Digitalen Dachmarke
[20.01.2026] Die Digitale Dachmarke gewinnt an Reichweite: Seit der Pilotphase Ende 2024 stieg die Zahl der eingebundenen Onlineservices von 17 auf rund 150. Der DigitalService des Bundes berichtet nun über Erfahrungen aus der Pilotierung und über Anpassungen bei Vergabe, Umsetzung und Betrieb. mehr...
Baden-Württemberg: Digitales Verkehrsmodell
[06.01.2026] Ein landesweites Verkehrsmodell bildet den Auto-, Bus-, Bahn-, Rad- und Fußverkehr sowie den Güterverkehr in Baden-Württemberg nun digital ab. Mit dem Modell steht dem Land künftig ein zentrales, leistungsfähiges Planungswerkzeug zur Verfügung. mehr...
Sachsen-Anhalt: Erneut Digitalisierungsideen gesucht
[06.01.2026] Das Land Sachsen-Anhalt sucht im Rahmen des Innovationswettbewerbs erneut innovative Digitalisierungsideen für die öffentliche Verwaltung. Noch bis zum 13. Februar können Ideen eingereicht werden. mehr...
Work4Germany: Fellowship für einen zukunftsfähigen Staat
[15.12.2025] Digitalisierung bedeutet nicht nur die Einführung neuer Technologien – sie verändert auch die Zusammenarbeit. Mit seinem Fellowship Programm Work4Germany möchte der DigitalService neue Arbeitsweisen in der Bundesverwaltung verankern. Die Bewerbungsfrist für den nächsten Durchgang startet jetzt. mehr...
Standardisierung: Standardverordnung Onlinezugang praktisch umsetzen
[12.12.2025] Im Juni hat der IT-Planungsrat die Standardverordnung Onlinezugang beschlossen, die im Oktober in Kraft getreten ist. Damit werden verbindliche Qualitätsanforderungen formuliert, welche die Verwaltung mit ihren digitalen Angeboten einhalten muss. DIN SPEC 66336 und der Servicestandard helfen, diese Vorgaben umzusetzen. mehr...
Bitkom-Befragung: Digitalpolitik ist den Deutschen wichtig
[02.12.2025] Eine neue Bitkom-Befragung zeigt: Die meisten Menschen wollen endlich einfache Online-Behördengänge. Auch Datenschutz, digitale Teilhabe und mehr Sicherheit im Netz zählen zu den wichtigsten Anliegen. Digitalpolitik ist für viele von großer Bedeutung. mehr...
Gesetzgebung: Praxisaustausch zum Digitalcheck
[01.12.2025] Im November fand zum zweiten Mal das Bund-Länder-Treffen zum Digitalcheck statt, auch Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission waren dabei. Die Teilnehmenden tauschten sich über Erfahrungen und Chancen praxis- und digitaltauglicher Gesetzgebung aus. mehr...